Gastbeitrag von: Chris
Mein Geburtstag ist seit vielen Jahren ein schwieriges Thema für mich. An einigen habe ich meine Mutter betrunken erlebt. An anderen merke ich, wie mir meine Zeit davon fliegt. Heute werde ich 22, doch schon jetzt habe ich das Gefühl, keine Jugend gehabt zu haben.
Schockierend finde ich aber vor allem den Gedanken, dass im Juli meine Schwester 21 wird. Es kommt mir so vor, als hätten wir beide einen großen Sprung in der Zeit gemacht, zwischen der mir nichts bleibt. Keine Erinnerungen, die es wert wären sie mit anderen zu teilen. Nichts was ich erlebt habe. Keine erste Liebe, keine Leidenschaft. Alleine ein grandios ruiniertes Abitur, mit einer anschließend einjährigen Arbeitslosigkeit. Und natürlich den mehr als eintausend Stunden Spielzeit, die ich in Star Trek Online investiert habe. Mein Geburtstag ruft in mir das Gefühl hervor, viel Zeit verloren zu haben, die ich nie wieder zurückbekommen werde.
Vielleicht ist es aber sogar ganz gut, älter zu werden. Ich bin selbstreflektierter geworden, ich arbeite aktiv an meinen Problemen und warte nicht mehr passiv auf das hoffentlich kommende. Ich weis jetzt, was mir wichtig ist und habe den Freiraum das auch umzusetzen. In meiner Jugend stand ich mir dagegen meist selbst im weg. Ich hatte nie ein Ziel vor Augen, wusste weder mit mir noch mit meinem Leben etwas anzufangen. Zwar folgte ich immer dem groß vorgegebenem Ziel, das Abitur zu schaffen; doch mir fehlten sowohl die Ideen für das Danach, als auch für das Hier und Jetzt. Stattdessen ließ ich alles schleifen, in der Hoffnung dass sich schon irrgendetwas ergibt.
Am liebsten möchte ich nun all das nachholen, was ich verpasst habe. Am besten soll sogar jedes Wochenende vollgepakt mit Action sein. Gleichzeitig merke ich jeden Sammstag, dass mir dafür dann entweder die Energie, oder die Interessen fehlen. Es scheint jedenfalls so, als seie ich sehr talentiert darin geworden, mir Aktivitäten auszureden, auf die ich mich zuvor noch gefreut hatte. Stattdesen liege ich dann im Bett und frage mich, wohin meine gestrige Leidenschaft verschwunden ist.
Die Erfahrungen meiner Jugend brachten mich schon früh nah an das Existenzielle. Nachdem mein Großvater an Parkinson gestorben ist, begann ich mich mehr mit meiner eigenen Sterblichkeit zu beschäftigen. Ich fragte mich, wie ich eigentlich sterben möchte. Was würde ich tun wollen, wenn ich einmal erführe, dass ich nurnoch einige Jahre zu leben hätte? Eines stand schon damals für mich fest: So will ich nicht in Erinnerung bleiben. Bis zu letzt hatte meine Familie mit Hilfe einer Pflegerin meinen Großvater zu Hause gepflegt. Stück für Stück verlor er seine Selbstständigkeit, benötigte immer mehr Hilfe. Bis er dann irrgendwann nurnoch liegen konnte. Noch heute frage ich mich, ob und was er in diesem Stadium der Krankheit noch von der Welt um ihm herum mitbekahm.
Sein Tod brachte für mich auch ein Stück Erleichterung. Sein Leiden war vorbei. Zwar glaube ich nicht, dass ich ihm eines Tages im Nachleben wiedersehen werde: Doch ich bin froh und dankbar zu wissen, dass er ein gutes Leben hatte. So will ich ihn in Erinnerung halten. Und so hoffe ich, dass mich die Menschen eines Tages in Erinnerung behalten werden.
Aus heutiger Sicht hätte mich diese Erkenntnis auch bestärken können. Ich hätte mich auf die Suche nach mir selbst machen und meinen eigenen Weg finden können. Doch die Angst zu versagen und der tiefe Zweifel an allem, haben mich leider immer gelähmt. Auf die Gefahr hin, dass sie wieder rückfällig, oder ich zu ihrer Zielscheibe werden könnte, traute ich mich leider nie von zu Hause auszubrechen. Ich meine damit nicht unbedingt ausschließlich den Auszug; es hätte mir schon viel gebracht einem Minijob nachzugehen, mit dessen Geld ich dann mit Freunden nach der Schule hätte Spaß haben können. Wo das Problem war? Noch letztes Jahr habe ich mich mit meiner Mutter häftigst gestritten, wenn ich spät ( damals 20 bis 21 Uhr ) nach Hause gekommen bin, um mir dann noch etwas kleines zum Essen machen zu wollen. Sie wollte mich dahingehend immer unter ihrer Kontrolle wissen, da gab es kaum Ausnahmen. Bevor mir klar wurde, dass sie Alkoholkrank war, hatte ich selten ein Problem mich ihr entgegenzustellen. Nach der Erkenntniss wuchs die Angst, sie damit zur Flasche greifen zu lassen. Die Angst sie damit entgültig zu verlieren, war mächtiger als mein Wunsch nach mehr Freiram.
Diese existenziellen Erfahrungen wirken in mir heute noch nach. Ich denke viel über das Leben nach. Ich frage mich oft, wie ich von anderen gesehen werde, welche Wirkung ich auf sie habe. Ich zweifle oft daran, ob ich ihr Leben bereichere, oder was ich tun kann um mich selbst zu verwirklichen. Oft heißt es, man solle seine schlimme Jugend hinter sich lassen. Ich denke das ist unmöglich. Die Vergangenheit ist wie sie ist. Was mir heute bleibt, ist aus meinen Fehlern zu lernen. Ich kann es anders machen. Ich kann mich dafür entscheiden, meinen Weg Abseits meiner destruktiven Beziehung zu meiner Mutter zu gehen.
Autor*in: Gastautor*in
Ab und an schreiben auch Gäste in unserem Blog. Gastbeiträge sind mit dem Namen "Gastautor*in" gekennzeichnet.

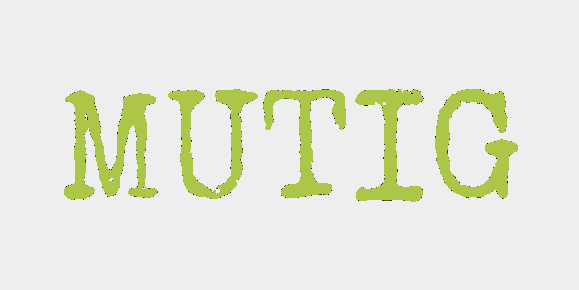
Lieber Chhu, ich wünsche dir nur das allerbeste für dein neues Lebensjahr! Viel Glück, Kraft, Durchhaltevermögen und was du sonst noch so gebrauchen kannst.
Denke immer an die letzten Sätze deines Beitrags: Die Vergangenheit können wir nicht ändern, aber auf die Zukunft haben wir einen Einfluss.