Letztens war ich die Plus-Eins auf einer Geburtstagsparty. Die Person, die meine Freundin eigentlich mitnehmen wollte, war abgesprungen, also tat ich ihr den Gefallen, und begleitete sie. Zu diesem Zeitpunkt wusste meine Freundin allerdings noch nicht, dass ich den Typen, auf dessen Geburtstagsfeier wir waren, eigentlich nicht mag. Ich erwähne es hier zwar, tut für den Gesamtzusammenhang aber überhaupt nichts zur Sache. Anyway, auch wenn ich quasi niemanden dort kannte, hatte ich einen ganz okayen Abend. Entspannte Leute, ein bisschen Alkohol hier, ein paar Joints da – ich hab‘ mich sogar zu zwei Runden Tischkicker hinreißen lassen. Gut, ich hab‘ beide Male verloren, war trotzdem spaßig – irgendwie. Während die Zeit verging, immer mehr Leute dazu kamen, die Stimmung ausgelassener wurde, merkte ich (wie so oft in letzter Zeit), dass ich eigentlich keinen Bock mehr hatte und nach Hause will. Ich war satt vom Essen, satt von den Leuten und vor allem: satt vom Gutgelaunt-sein-müssen. Alles was ich wollte, war auf einem Spaziergang nach Hause meine gesammelten Eindrücke verarbeiten, dabei meine Kopfhörer aufsetzen und den Künstler, den ich gerade neu auf Spotify entdeckt hatte, auschecken. Also entschied ich mich, nicht noch mit den anderen in den Club zu gehen, sondern ohne großes Abschiedsheckmeck einfach abzudampfen. Nur meiner Freundin habe ich Tschüss gesagt. Ende der Geschichte.
Soll ich euch verraten, warum ich diese völlig unspektakuläre Freitagabendstory trotzdem mit euch teile? (Ist nur eine rhetorische Frage)
Früher dachte ich, ich sei gern unter Leuten. Gemeinsam abhängen, lachen, feiern, trinken, lustig sein – Gruppendynamiken halt. Lautes Gebrabbel, Musik, neue Menschen kennenlernen, die ausgelassen und einfach locker sind. Das war schon immer mein Ding – jedenfalls dachte ich das. Eigentlich strengt mich sowas nämlich total an und ich hab‘ schnell die Nase voll. Warum? Wartet’s ab!
Meistens komme ich gut bei anderen an, die Menschen finden mich interessant, suchen das Gespräch mit mir, wollen mich kennenlernen. Das klingt jetzt komisch und kommt etwas abgehoben rüber aber: wenn ich irgendwo auftauche, einen Raum betrete oder in einer Gruppe dazu komme, falle ich auf. Das war schon immer so; meine Hautfarbe (nicht weiß), meine Haare (nicht glatt), mein Gesicht (nennen wir es „speziell“). Ich kleide mich außerdem in einer Weise, von der viele Leute sagen: stylisch. Ich verstehe es, mich in Gespräche einzubringen, kann zu allen möglichen Themen etwas sagen, kann gut auf Leute zugehen, noch dazu bin ich witzig und klug – bla bla bla. Diese Ausführungen lesen sich so, als wäre ich als Kind in einen Topf voll Selbstbewusstseinselixir gefallen. Spoiler alert: Genau das Gegenteil ist der Fall!
Wenn die Leute mich ansehen, sehen sie nicht, wie ich vor lauter Unsicherheit an dem Zippo in meiner linken Hosentasche rumfummele. Manchmal ist es auch ein Heilstein. Ein Rhodonit um genau zu sein, aber das ist nur ein weiterer random fact.
Mein ach so stylisches Outfit, für das ich hier und da Props bekomme: nichts weiter als meine Rüstung, eine Kompensationsstrategie. Niemand – nicht einmal ich – soll merken, dass ich mich eigentlich fühle, als könne man durch mich hindurchsehen, als wäre ich aus Glas, splitternd, nur eine Erschütterung vorm Zerbersten entfernt. Während sich Leute angeregt mit mir unterhalten, anfangen, mich sympathisch zu finden, registrieren sie nicht, dass ich permanent versuche, meine sich mir aufdrängenden Selbsthassgedanken wegzuatmen, meistens mit einer Kippe in der Hand. Vor lauter Angst, man könne hören, wie die Stimme in meinem Kopf durch ein Megafon schreit: „Achtung, Achtung. Ich bin ein Alien!“, lenke ich das Gespräch immer wieder auf mein Gegenüber – gebe ihr oder ihm ein gutes Gefühl, lächle, bin interessiert, stelle Fragen, höre zu, gebe entweder einen smarten Ratschlag oder einen lustigen Spruch zum Besten. Leute, ich kann euch sagen: dieser Automatismus funktioniert erschreckend gut.
Was keiner ahnt, ist, dass ich mir schon zu Beginn eines Get-togethers überlege, wie ich es schaffe, einen unauffälligen Abgang zu machen, nach einem möglichen Fluchtweg Ausschau halte, ich mich in Wirklichkeit von Minute zu Minute quäle, eigentlich nur nach Hause und meine Ruhe haben will; mir nichts sehnlicher wünsche, als mein Schauspiel endlich zu beenden, weil mich diese Show einfach nur langweilt. Warum ich sie trotzdem immer und immer wieder bis zum Umfallen aufgeführt habe? Ganz einfach: Weil ich die längste Zeit meines Lebens einfach nicht die sein wollte, die ich hinter der Maske bin. Ich wollte die sein, von der die Anderen glaubten, sie zu sehen. Diese Maskenperson ist cool, zieht durch, macht Party und geht nicht früh nach Hause. Diese Maskenperson ist nicht depressiv, nicht einsam, nicht voller Ängste, Zwänge, Selbstzweifel und Unzulänglichkeiten. Ich hoffte so sehr, dass, wenn ich die anderen oft und lange genug von der Maskenperson, der Illusion meiner Selbst überzeugen kann, ich mich irgendwann in dieses Trugbild verwandle und die Armee der inneren Henker endlich Ruhe gibt. Tja, hätte ja klappen können…
Dank meiner mittlerweile zweijährigen Psychotherapie habe ich keinen Bock mehr darauf, nur zu spielen. Ich will die Person sein, die ohne zu zucken früh nach Hause geht, während die coolen Kids noch ein bisschen weiter machen. Heute will ich die Person sein, die wegen ihrer bedauernswerten Kindheit Struggles im zwischenmenschlichen Bereich hat. Ich will die Person sein, die, wegen der Dinge, die sie erleiden musste, krasse Selbstwert-Issues hat. Wie ich das wollen kann? Weil diese Person Unvorstellbares überlebt hat und trotzdem jeden Tag versucht aufzustehen (wenn auch manchmal mehr schlecht als recht). Weil diese Person, die vermutlich stärkste Person ist, die ich je kennenlernen durfte. Weil mich diese Person Tag für Tag inspiriert. Weil diese Person einfach ich bin und ich das mittlerweile gut so finde. Naja… meistens jedenfalls;)
Gastbeitrag von Sky Walker
Autor*in: Sky Walker
Die längste Zeit meines Lebens war ich der Überzeugung, ich sei einfach anders als die meisten Menschen – nicht ganz „normal“. Ich litt unter meiner inneren Verfasstheit, die das Resultat meiner problematischen Kindheit ist und versuchte jeden Tag aufs Neue, irgendwie mit mir und der Welt klarzukommen. Diverse Ängste, rezidivierende Depressionen, ein Helfersyndrom, Leistungssucht und Perfektionismus sind nur einige meiner ständigen Begleiter. Angetrieben von der ständigen Suche nach dem Sinn meiner Existenz kam es Anfang 2021 zum Totalausfall: 30 Jahre jung, studierunfähig, arbeitsunfähig, lebensunfähig. Nix ging mehr und ich war buchstäblich gezwungen, mich um meine seelische Gesundheit zu kümmern. Seither befinde ich mich auf dem beschwerlichen und doch lohnenswerten Weg der Heilung. Hier im Blog möchte ich über die Schwierigkeiten schreiben, die mein Leben mit komplexen Traumafolgestörungen mit sich bringt und darüber, wie es mir Schritt für Schritt gelingt, besser mit diesen Hustles umzugehen. Außerdem überlege ich (wenn ich mal groß bin:), eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Misshandlungserfahrungen in der Kindheit zu gründen – bis dahin lerne ich, was es dafür braucht, lasse mich von den Selbsthilfegruppen-Erfahrungen Anderer inspirieren und genieße es, mit ihnen im Austausch zu sein. In diesem Sinne: man liest sich!

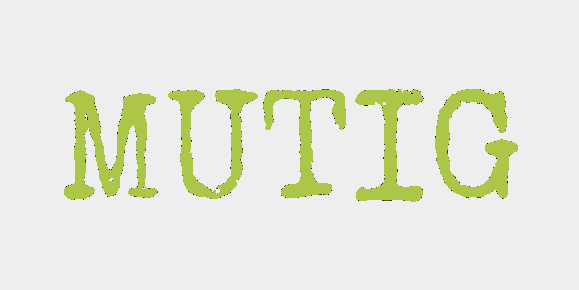
Wow! ich bin fasziniert von deinem Schreibstil.
Ich kann das so gut nachvollziehen, ich glaube jeder Mensch der irgendwie Struggels hat kennt das nur zu gut. Schauspiel, mit der besten Maske überhaupt, innerlich fast zerbrechen, weil die Angst so groß ist jeder Zeit auffliegen zu können. So kenne ich das jedenfalls.
Ich bin froh das du diese Maskerade beenden willst und das Schauspiel an den Haken hängen willst. Authentizität ist so viel wichtiger als nur funktional in der Gesellschaft zu koexistieren. Ich glaube man kann erst dann heilen und sich annehmen wie man ist, wenn man authentisch ist.
Ich wünsche dir viel Kraft für deine kommenden Herausforderungen und bin gespannt mehr von dir zu lesen, falls du weiter Lust haben solltest 🙂
LG Blue