Wenn ich gefragt werde, worauf ich Lust habe, was ich möchte, wonach mir der Sinn steht, brauche ich deutlich mehr Zeit als andere, um mir die Fragen erstmal selbst zu beantworten. Blöd also, wenn’s in der Gruppe schnell gehen muss. Schon setzt das Gefühl der Scham ein, weil… wieso muss man erstmal so lange darüber nachdenken? Wenn ich dann eine vage Vorstellung davon habe, was ich wollen könnte, macht sich Angst in mir breit. Angst davor, mit meinem Bedürfnis auf Ablehnung zu stoßen, nicht gehört zu werden und davor, dass mein Bedürfnis unbedeutend, lächerlich oder gar nervig ist.
So tendiere ich dazu, mich nur sehr leise und unkonkret zu äußern oder mich unterzuordnen und den anderen die Entscheidung zu überlassen. Wenn letzteres dann eintritt (was häufiger der Fall ist), überkommt mich eine Art Wut. Weniger auf die anderen, eher auf mich selbst. Ich werde wütend darüber, dass ich, weil ich unfähig bin, für mich und meine Wünsche einzustehen, „gezwungen“ bin, Dinge zu tun, auf die ich eigentlich keine Lust habe, die mich stressen, oder für die ich eine gewisse (mentale und/oder instrumentelle) Vorbereitung gebraucht hätte. Dann muss ich ziemlich viel Energie dafür aufbringen, mir meine Gefühlslage nicht anmerken zu lassen, denn ich will ja nicht die Stimmung drücken oder dass die anderen denken, irgendwas stimmt nicht mit mir. Merken meine Kompagnons dann doch, dass was mit mir ist, versuchen sie meistens irgendwas zu tun, damit sich meine scheinbar doch spürbare Anspannung löst. Sie fragen nach meinem Befinden, machen alternative Vorschläge, wollen mir etwas abnehmen, helfen mir dabei, in der prallen Sonne ein schattiges Plätzchen für mich herzurichten.
Statt einfach nur dankbar zu sein, schäme ich mich dann dafür, diese Form der Aufmerksamkeit zu kriegen. Verlegen versuche ich mein inneres Chaos zu überspielen – zwar nicht unbedingt oscarreif, reicht aber, um einigermaßen über den Tag zu kommen. In solchen Momenten einfach ehrlich sagen was los ist? Na nee! Dann würde die Gefühlsachterbahn ja von neuem starten. Achterbahnfahrten mochte ich noch nie. Stattdessen wird’s Zeit für die Endgegnerin: Vorhang auf, hier kommt die Schuld. Mein Gewissen holt zum finalen Peitschenhieb aus. Andere müssen augenscheinlich die Verantwortung für das Wohlergehen einer Anfang 30jährigen Frau übernehmen, weil sie nicht im Stande ist, selbst für ihre Bedürfnisbefriedigung zu sorgen? Geht ja mal gar nicht! Ich fühle mich schlecht, mache mir Vorwürfe und würde mich am liebsten permanent für mich entschuldigen, will wieder gut machen, dass ich überhaupt existiere… Ich sag ja: Stress pur!
Wenn ich es nach einer gefühlten Ewigkeit dann schaffe, die sogenannte „Metaebene“ einzunehmen – mir also bewusst wird, dass mein destruktives Denken gerade mal wieder völlig ausufert – heißt es Ärmel hochkrempeln und den Selbsthassmonologen in meinem Kopf auf möglichst wohlwollende Art und Weise zu begegnen. Ist zwar ein ungeheurer Kraftakt, aber das ist das, was mir mein Therapeut rät. Also spüre ich in mich hinein, reflektiere mein Verhalten und inwieweit dieses einen Einfluss auf das Verhalten meines Umfelds nimmt. Kurzum: ich bin recht viel in meinem Kopf unterwegs. Das führt dazu, dass ich in den meisten Momenten zwar irgendwie dabei aber nicht richtig da bin. Eine Tatsache, die mich oft sehr traurig stimmt. Auch wenn der Spannungsbogen meines bisherigen Beitrags noch nicht eindeutig erkennbar ist, versuche ich jetzt einen Schlussteil zu formulieren und diesen viel zu lang geratenen Text einigermaßen abzurunden.
Mein Urlaub nahm ab der hälfte der Zeit eine Wendung. Als ich in einer sternenklaren Nacht bei einer Zigarette auf dem Balkon so vor mich hin sinnierte, wurde mir klar, dass ich genau zwei Möglichkeiten hatte, den Urlaub fortzuführen: Entweder, ich mache weiter wie bisher, füge mich, halte meine Gefühle, Gedanken sowie deren Konsequenzen einfach nur aus, bis ich wieder nach Hause fahre und speichere den Urlaub im Nachhinein als so lala ab. Oder ich nehme meinen ganzen Mut zusammen, gehe Hand in Hand mit meinen Ängsten auf meine Freundin zu, sage ihr, dass ich lieber dieses statt jenes machen wollen würde und erkläre ihr, warum es mir bisher so schwergefallen ist, damit rauszurücken. Beim Abwägen musste ich – wie so oft – an die Worte meines Therapeuten denken: Wenn sich neue Verhaltensweisen bei mir einstellen sollen, muss ich neue Erfahrungen machen. Ich muss mein Gehirn umkonditionieren, ihm die Möglichkeit geben, zu lernen, dass bei der Äußerung meiner Bedürfnisse keine Strafe droht. Ich muss meinem inneren Kind zeigen, dass mein erwachsenes Ich viel besser darin ist, Verantwortung für mich und meine Grenzen zu übernehmen, als es meine Eltern waren. Klar, der Gedanke daran, dass ich das etwa 1000 Male durchmachen muss, bis es in meiner Hirnmaterie angekommen ist, wirkt erstmal abschreckend, aber wenn ich nie mit dem ersten Mal beginne, treten die weiteren 999 ja auch nicht ein. Also stand ich auf, ging zu ihr und suchte das Gespräch. Mit einem Puls von gefühlt 500 (ja genau, Kammerflimmern), öffnete ich mich ihr gegenüber. Die Erleichterung, die sich währenddessen einstellte, ist unbeschreiblich. Es tat so gut, so ehrlich zu sein, für mich einzustehen und dafür auf Akzeptanz und Wertschätzung zu stoßen. Das Gespräch hat meinem rudimentären Selbstbewusstsein einen enormen Boost gegeben und mir gelang es, in den darauffolgenden Tagen viel häufiger (wenn auch nicht in 100% der Fälle;) zu sagen, was ich essen, unternehmen oder eben nicht machen will. Das hat meinen Urlaub zu einem wirklich coolen Trip und mich letztendlich ziemlich stolz gemacht. Dass man allerdings auch irgendwie damit dealen muss, dass die eigenen Bedürfnisse und Grenzen den Wünschen
der anderen zuwiderlaufen können und dies der einen oder anderen Diskussion bedarf, steht auf einem anderen Blatt…
Gastbeitrag von Sky Walker
Autor*in: Sky Walker
Die längste Zeit meines Lebens war ich der Überzeugung, ich sei einfach anders als die meisten Menschen – nicht ganz „normal“. Ich litt unter meiner inneren Verfasstheit, die das Resultat meiner problematischen Kindheit ist und versuchte jeden Tag aufs Neue, irgendwie mit mir und der Welt klarzukommen. Diverse Ängste, rezidivierende Depressionen, ein Helfersyndrom, Leistungssucht und Perfektionismus sind nur einige meiner ständigen Begleiter. Angetrieben von der ständigen Suche nach dem Sinn meiner Existenz kam es Anfang 2021 zum Totalausfall: 30 Jahre jung, studierunfähig, arbeitsunfähig, lebensunfähig. Nix ging mehr und ich war buchstäblich gezwungen, mich um meine seelische Gesundheit zu kümmern. Seither befinde ich mich auf dem beschwerlichen und doch lohnenswerten Weg der Heilung. Hier im Blog möchte ich über die Schwierigkeiten schreiben, die mein Leben mit komplexen Traumafolgestörungen mit sich bringt und darüber, wie es mir Schritt für Schritt gelingt, besser mit diesen Hustles umzugehen. Außerdem überlege ich (wenn ich mal groß bin:), eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Misshandlungserfahrungen in der Kindheit zu gründen – bis dahin lerne ich, was es dafür braucht, lasse mich von den Selbsthilfegruppen-Erfahrungen Anderer inspirieren und genieße es, mit ihnen im Austausch zu sein. In diesem Sinne: man liest sich!

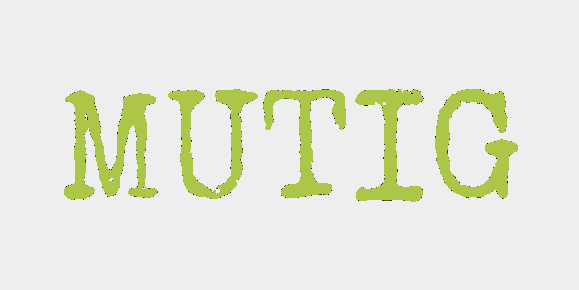
Neueste Kommentare