Für mich galt lange Zeit vor allem die Devise: Alles unter einen Hut bekommen, koste es, was es wolle. Ich war schon immer ein Freund davon, meinen Alltag klar zu strukturieren, To-Do-Listen zu erstellen und sie Tag für Tag abzuarbeiten. Das gab mir eine gewisse Routine und das Gefühl, alles im Griff zu haben.
Habe ich etwas nicht nach meinem Zeitplan oder nach meinen Ansprüchen geschafft oder kam etwas unvorhergesehen dazwischen, fühlte es sich nach Versagen an. Ich bin meinen eigenen Ansprüchen (und in meinem Kopf waren es auch die Ansprüche der Menschen um mich herum) in diesen Momenten nicht gerecht geworden.
Problematisch war es für mich vor allem dann, wenn sich der Alltag in meinem Leben extrem änderte. Zum Beispiel der Übergang von Schule zu Studium oder vom Studium in den ersten Job. Letzterer war noch verbunden mit einem Umzug in eine andere Stadt, in eine WG und weit weg von Freunden und Familie. Das warf meine geliebte Routine plötzlich komplett um. Der Alltagsablauf war ein völlig anderer, genau wie die Lebensumstände. Genau dieser Verlust meiner vorherigen vertrauten Routine gab mir ein Gefühl von Hilflosigkeit, von „einfach umhertreiben“. Wie reagierte ich also darauf? Mit einem neuen, klar strukturierten Wochenplan, der abgearbeitet werden musste. Wichtig war mir dabei, neben den Pflichten, wie Haushalt und Arbeit, auch meine Hobbys nicht zu vernachlässigen. Zudem wollte ich auch noch neue Leute in der neuen Stadt kennenlernen, um mir ein neues Freundenetz aufzubauen. Das alles resultierte zwangsläufig darin, dass ich neben meiner neuen Arbeitsstelle, die mir schon psychisch viel Stress abverlangte, ein vollgepacktes Nach-Feierabend-Programm erstellte, mit Haushaltsdingen, Sport, Telefonaten mit der Familie und Freunden und „neue Dinge ausprobieren“.
Drei Monate etwa zog ich das so durch. Inzwischen hatte sich alles schon so verfestigt, dass ich Dinge nicht mehr gemacht habe, weil ich Lust dazu hatte (selbst mein geliebter Sport nicht mehr), sondern weil ich sie machen musste, da sie ja ein Punkt auf meiner Liste waren. Und die Liste nicht so abzuarbeiten wie angedacht, kam nicht in Frage. Nach drei Monaten kam eine weitere Veränderung hinzu: eine neue Beziehung, genauer gesagt: eine Fernbeziehung. Bedeutete konkret: mein Wochenplan musste nun in die Zeit zwischen Montag und Donnerstag gestopft werden, da die Wochenenden nun mit Pendeln belegt waren. Und die Liste nicht so abzuarbeiten wie angedacht, kam, wie gesagt, nicht in Frage.
Es kamen natürlich – so wie das im Leben immer ist – unvorhergesehene Dinge dazwischen; Pläne änderten sich und so weiter. Jedes Mal bedeutete das einen enormen Stressfaktor, da ich meinen Plan umstellen musste und immer die Angst mitschwang, es nicht zu schaffen, also zu versagen.
Ein gutes halbes Jahr später, war ich von meinen Ansprüchen und dem Zeitplanverfahren ausgelaugt und nervlich komplett am Ende. Es hatte dazu geführt, dass ich absolut keine Flexibilität mehr hatte, keine Freude mehr am Tun empfand und das Erfüllen von Aufgaben nicht als Erfolg, sondern Selbstverständlichkeit empfand. Es kam, wie es kommen musste: der komplette Zusammenbruch mit längerem Tagesklinikaufenthalt.
Nun, mit ein paar Jahren Abstand und weiterer Verhaltenstherapie, habe ich für mich Folgendes erarbeitet und festgestellt: To-Do-Listen sind für mich nach wie vor eine gute Stütze, um meine Woche zu strukturieren. Sie helfen mir auch dabei, das Gefühl gering zu halten, zu wenig Zeit für alles zu haben. Der wichtige Unterschied aber ist nun, dass ich mir bewusst Zeit einräume für Dinge, die mir Spaß machen und dass ich ganz klar weiß, dass sich immer wieder etwas ändern kann an dem Plan. Er ist also nicht so in Stein gemeißelt wie in den Jahren zuvor. Es ist die nötige Lockerheit drin und das Wissen: Selbst wenn ich nicht alles schaffen sollte, gibt es immer noch eine Woche danach und noch eine Woche danach. Denn wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, sind die wenigsten Dinge so wichtig, dass sie unmittelbar gemacht werden müssten und nicht noch etwas liegen bleiben könnten.
Unvorhergesehenes mag ich immer noch nicht besonders und manchmal steigt der Stresspegel wieder rasant an, wenn sich Pläne ändern. Aber inzwischen habe ich das besser im Griff und finde schneller eine Lösung für mich, damit umzugehen. Wie so oft in der Genesungszeit braucht auch eben das Übung und Zeit.
Autor*in: kopfstark
Seit ich denken kann begleitet mich die Angst. Nicht so, wie sie jeden Menschen begleitet, sondern ständig und in den meisten Fällen unbegründet (objektiv betrachtet). Seit ich ein kleines Mädchen bin, habe ich Therapieerfahrung gesammelt und durch ständiges An-Mir-Selbst-Arbeiten viel über mich, das Leben und die Psyche gelernt. Hier möchte ich gerne etwas davon teilen.


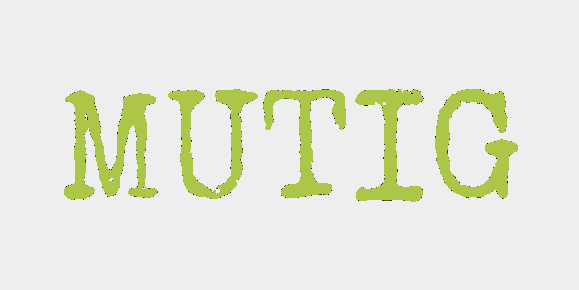
Danke für deinen Beitrag. Ich kenne das Gefühl, zu wenig Zeit für alles zu haben auch sehr gut und habe mir entsprechend auch schon immer viel Gedanken über die richtige Art von Planung, Listen usw. gemacht. Aber mittlerweile denke ich, dass es für mich weniger darum gehen sollte, die richtige Art von Planung zu finden, sondern eher darum, diesem bekloppten Gefühl, immer Ergebnisse bringen zu müssen, eins auf den Deckel zu geben. Hast du oder haben andere hier Ideen, wie man seinen inneren Antreiber zum Innehalten bekommt?
Viele Grüße
Puh, ja ich weiß genau, was du meinst. Mir persönlich hilft es immer, mir vor Augen zu führen, wohin mich das alles gebracht hat. Dann frage ich mich selbst, ob es das wirklich Wert ist (ist es übrigens nie). Ich habe einfach in den letzten Jahren festgestellt, dass ich Pausen brauche und sie mir Kraft für Weiteres geben. Es hat aber seine Zeit gebraucht, das zu realisieren und auch zu akzeptieren.