Alle sechs Monate muss ich zum MRT. Jedes Mal habe ich den gleichen Wunsch: Dass alles in Ordnung ist.
Ich liege auf der Liege des MRT-Gerätes und sage noch schnell, dass sie mich in Ruhe lassen und nichts sagen sollen, weil ich es schon merke, wenn das Kontrastmittel gespritzt wird. Als die MRT-Aufnahme los geht, schlafe ich ein. Nach 45 Minuten schrecke ich auf, weil das MRT auf einmal zu Ende ist. Ich habe es wieder einmal geschafft.
Nun geht es zurück in die Umkleide. Wo ich nochmals zehn Minuten auf die CD mit den Aufnahmen warte. Danach gehe ich schnell aus der Umkleide raus. Wie immer lege ich noch im Wartezimmer ein paar Flyer von meiner Selbsthilfegruppe aus.
Dann wird es ernst: Mit den Aufnahmen gehe ich sofort zur Auswertung zu meinem Neurochirurgen in die Klinik. Auf dem Weg zur Klinik trinke ich erst mal richtig viel. In der Neurochirurgischen Ambulanz werde ich sehr freundlich begrüßt. Nachdem ich meinen Koffer mit den Aufnahmen abgeliefert habe, unterhalte ich mich erst mal ein wenig mit der Schwester. Mein Neurochirurg steht an der Tür vom Wartezimmer und winkt mich lächelnd zu sich. Ich wundere mich, er sieht so anders aus, er hat jetzt einen Vollbart. Ich frage ihn, was los sei, er lächelt und sagt, es wäre ihm zu lästig, sich jeden Tag zu rasieren. Ich kann ihn voll verstehen. Danach gehen wir in sein Ärztezimmer, er zeigte mir die Bilder. Na, fragt er mich, sehen Sie was? Ich verneine das.
Ich sehe zwar ein 4×5 Zentimeter großes Loch, denn fast die Hälfte von meinem Gehirn wurde vom Tumor weggedrückt (das Gehirn bleibt nach der OP an der Stelle wo es ist. Die Stelle, wo der Tumor war, füllt sich mit Liquor (Hirnwasser)). Aber auch dieses Mal waren keine Veränderungen zu sehen. Mein Arzt sagt, dass ich für Neurochirurgen langweilig bin. Innerlich fällt mir ein großer Stein vom Herzen. Mit meinem Arzt rede ich dann wie meistens noch ein bisschen über meine Selbsthilfegruppe. Er hat unsere Visitenkarten und er schickt alle, die eine frische Diagnose bekommen haben, zu uns. Fast die Hälfte in unserer Gruppe ist durch ihn zu uns gekommen. Vielen von ihnen geht es viel sehr schlechter als mir.
Wir reden noch ein wenig über Möglichkeiten, auf die Selbsthilfegruppe aufmerksam zu machen, z.B. Werbung auf den Stationen, und über einen Vortag in der Selbsthilfegruppe. Er sagt, alles ist möglich. Ich freute mich und gehe wieder zur Schwester und lasse mir neue Termine geben für Juni 2019. Denn ich habe jetzt erst einmal wieder ein halbes Jahr Ruhe.
Dann kommt der Wunsch, dass alles in Ordnung ist, wieder. Und ich hoffe, dass er sich dann auch wiedererfüllt. Ich bin zufrieden und verteile noch Flyer auf der Station. Danach rufe ich wieder meine Eltern an und informiere sie. Jetzt bin ich wieder zurück im Leben.
Autor*in: Dresdener
Ich bin Stephan, 39 Jahre alt und komme aus Dresden. 2005 und 2008 bin ich an einen bösartigen Hirntumor erkrankt. Jetzt bin ich erwerbsunfähig und bekomme Rente. Ich habe eine Selbsthilfegruppe für Hirntumorpatienten und Angehörige gegründet und bin auf verschiedene Weise ehrenamtlich aktiv.

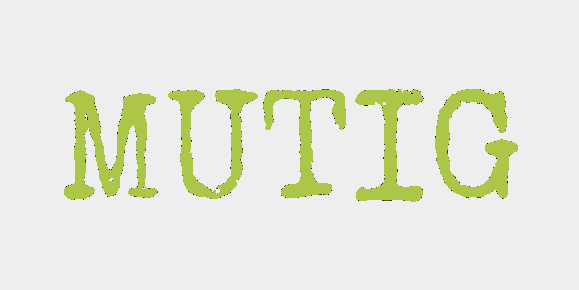
Moin Stephan,
vielen Dank für den schönen Text! Der Vergleich mit dem TÜV ist so gut! 😀
Wegen meiner MS bin ich ja auch regelmäßig Gast in der Technoröhre, mein Wunsch ist dann ähnlich wie bei Dir: Das alles in Ordnung ist.
Ich hoffe wir sehen uns 2019 wieder beim nächsten Bundestreffen JSH!
Lieben Gruß
André
Hi Dresdener,
Das freut mich, dass dieses Mal dein Wunsch wieder in Erfüllung gegangen ist.
Dir eine schöne Weihnachtszeit und guten Rutsch.
Liebe Grüße von Wheely Girl.
Fühl dich gedrückt.